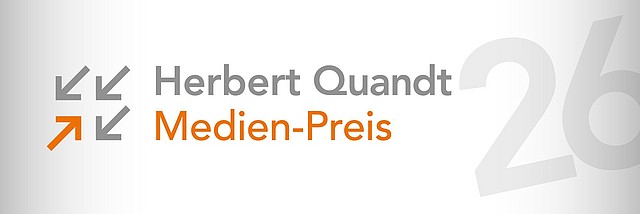Medienpreis


Bewerbungsfrist abgelaufen
Das Fenster für Bewerbungen zum Herbert Quandt Medien-Preis 2026 ist geschlossen. Wir danken allen, die Vorschläge gemacht und Beiträge eingereicht haben.
Ende März 2026 werden wir die Longlist des diesjährigen Herbert Quandt Medien-Preises veröffentlichen. Falls Sie informiert werden möchten und unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, melden Sie sich gerne unten auf dieser Seite an. Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Ihre
Johanna-Quandt-Stiftung

Wie werden wir resilienter?
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Welt ist augenscheinlich aus den Fugen. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir: Der morgendliche Blick auf das Smartphone folgt nicht mehr der Haltung “Was gibt’s Neues?”, sondern eher einer Haltung des „Was ist nun schon wieder passiert?“. Die FAZ konstatierte dazu jüngst in einem Leitartikel:
"Die Welt droht in Blöcke zu zerfallen, die gegen- statt miteinander arbeiten."
"Auge um Auge, Zoll um Zoll“ – auf diese archaische Formel könnte man die Lage der Weltwirtschaft derzeit bringen. Bei vielen Akteuren in Wirtschaft und Politik sehen wir daher Überlegungen, wie sich Abhängigkeiten und Verwundbarkeiten verringern lassen. Einige Stichworte dazu sind Ihnen bestens bekannt: Reshoring, Decoupling und Local for local.
Vielleicht sollten wir in Deutschland und auch in Europa jedoch nicht allzu seismographisch auf alle Eruptionen, Drohungen und Ankündigungen aus den USA reagieren. Zumal eine geordnete Reaktion ohnehin nur schwer möglich ist, wenn die einzige Kontinuität die Diskontinuität zu sein scheint.

Der Herbert Quandt Medien-Preis 2025 geht an:
- Miguel Helm für seine Reportage „Eilt sehr – aber nichts passiert“, erschienen am 29. August 2024 in der Wochenzeitung Die Zeit
- Tatjana Mischke für ihre Dokumentation „Viele Normen – Teure Wohnungen?“, ausgestrahlt am 16.04.2024 im SWR-Fernsehen (SWR-Story)
- Maren Adler für ihre Reportage-Serie „Erfolgreich durch die Wirtschaftskrise“, ausgestrahlt vom HR-Fernsehen (Hessenschau) ab Dezember 2024
- Laura Borchardt und Julia Saldenholz für ihre Dokumentation „Herr D. sucht die Fachkraft“, ausgestrahlt am 26. Februar 2024 im NDR-Fernsehen (NDR-Story)
Rund 230 Einreichungen hat die Johanna-Quandt-Stiftung erhalten. Der Preis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert.
Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich!

12.500 Euro Preisgeld für Miguel Helm
-

Miguel Helm ist eine herausragende Reportage über Bürokratie in Deutschland gelungen: „Eilt sehr – aber nichts passiert“, erschienen am 29. August 2024 in der Wochenzeitung Die Zeit, schildert anhand zweier Beispiele, wie Behörden durch überbordenden Regulierungseifer Initiative und Unternehmertum Fesseln anlegen:
Eine familiengeführte Metzgerei in der hessischen Wetterau schließt einen ihrer zwei Standorte, nachdem das Veterinäramt plötzlich verlangt, den Innenhof zwischen Kühl- und Verkaufsraum zu überdachen.
Die Reaktivierung einer stillgelegten Bahnverbindung im Schwarzwald, ein wichtiges Infrastrukturprojekt für die Region, droht an Fledermäusen zu scheitern, die sich in zwei stillgelegten Tunneln angesiedelt haben.
Miguel Helm überzeugt mit einer stilistisch präzisen und lebendigen Bildsprache. Er verfällt nicht in wohlfeiles „Bürokratie-Bashing“, sondern wägt Sinn und Unsinn von Regulierung sachlich gegeneinander ab.
Das Fazit der Jury: Ein gelungenes Stück, das keine einfachen Antworten auftischt, sondern viele Anregungen zum Nachdenken gibt.
-

“Sätze, die hängen bleiben”
Der ratlose Metzger und der verzweifelte Landrat. Was die beiden eint, ist der Frust über den Wust von Regelungen, die sich auch gerne mal widersprechen – deren Sinn sich nicht erschließt. Es gibt viele Artikel über den Sinn und Unsinn unserer Verwaltung. Miguel Helm musste man zum Jagen tragen. Sein Lieblingsthema war das nicht. Aber dann will er es genau wissen, wie sich Regeln auswirken. Auf die Unternehmen, auf die Menschen. Wieviel hält man aus – wann ist Schluss?
Metzger Jost hat Angst, etwas falsch zu machen bei den vielen Verordnungen, die er nicht mehr versteht. Er erstellt Listen wie lange er Wurstfleisch gart, wie er was würzt – was wie lange wo lagert. Das macht er alles mit, aber am Ende ist es die Verordnung 852/2004 Anhang II, Kapitel 1, Nr. 2, die Metzger Jost zum Aufgeben bringt. Er soll einen 10 m langen Weg überdachen, weil auf dem Weg vom Kühlhaus zum Verkauf Keime ins Fleisch geraten könnten. An der frischen Luft und abgedeckt – innerhalb von 10 Sek.? Das war das I-Tüpfelchen, das fehlte. Die Filiale wurde geschlossen.
Miguel Helm erzählt die Geschichte nüchtern mit klarer, präziser Sprache. Es sind kurze Sätze – jeder einzelne sitzt. Sätze, die hängen bleiben. Die Geschichte liest sich wie ein Bericht. Er ist Beobachter und Zuhörer. Er stellt sich nicht auf eine Seite – erzählt ohne Emotionen, sachlich, klar und mit großer Erzählkraft. Mit dem Leser macht das was – still leidet man mit. Am liebsten möchte man die Regeln sofort über Bord werfen, die Metzgerei wieder aufmachen, damit in Roßdorf die alte Dame wieder ihr Kochfleisch bekommt.
Trotz aller Widersprüchlichkeiten führt Miguel Helm aber nicht nur das Klagelied gegen die Bürokratie. Deutschland hält die Regeln nun mal besonders gut ein und oft fehlt den Behörden der Bezug zur Praxis und zu denen, die die Regeln anwenden und erfüllen müssen.
Helm erinnert an die vielen Fleischskandale und fragt – will man weniger Schutz, damit Metzger Jost überlebt? Bürokratie ist die Antwort auf gesellschaftliche Probleme. Der Rechtsstaat lebt, weil die Verwaltung nach Gesetzen handelt – so lässt er es den Verwaltungswissenschaftler sagen, der aber natürlich nicht mit denen spricht, die das zu erfüllen haben.
Und dann ist da noch Landrat Riegger, der für seine Gemeinde nur das Beste will. Die Region soll zukunftssicher werden durch eine bessere Anbindung. Rieger aber ist ausgebremst von Behörden, von Verbänden und von der Fledermaus – von Tausenden von Fledermäusen – vielen verschiedenen Arten. Es klingt wie eine Posse – eine teure Posse.
Helm beschreibt wie übertriebene Regelungen Bürger und Staat entfremden. Sich fast feindlich zumindest aber verständnislos gegenüberstehen. Die Dinge sind komplex – sehr komplex und jeder sehnt sich doch nach einfacheren Regeln und einfacheren Antworten. Doch die gibt es nicht.
Die Politik weiß um diese Entfremdung und wirbt mit Entbürokratisierung – alle Kanzler spätestens seit Helmut Schmidt hatten das Thema auf der Agenda, dazu die Innen- und Justizminister oder auch Edmund Stoiber in Brüssel – doch egal, wer das bisher anpackte – es fehlte der große Wurf – spürbare Verbesserungen: Fehlanzeige. Auch die neue Regierung will das Thema anpacken – es eilt.
Zum Schluss weist Miguel Helm auf etwas Versöhnliches hin: auf den Praxis-Check – bei dem sich Politiker, Unternehmer und Behörden zusammensetzen, um die Probleme gemeinsam anzugehen. Gegenseitig zuhören, verstehen, handeln – es könnte so einfach sein – doch überzeugt klingt Helm am Ende seiner Reise durch den Bürokratiedschungel Deutschlands nicht. Es gibt immer einen, der die Sinnhaftigkeit der Regeln verteidigt und nicht loslassen kann.
Diese schnörkellos und nüchtern erzählte Geschichte ist herausragender Journalismus, der an Beispielen unsere überbordende Bürokratie von allen Seiten beleuchtet. Gerne zeichnen wir deshalb „Eilt sehr – passiert ist nichts“ mit großer Freude mit dem Herbert Quandt-Medienpreis aus.

12.500 Euro Preisgeld für Tatjana Mischke
-

Tatjana Mischke hinterfragt in ihrer Dokumentation „Viele Normen – Teure Wohnungen?“, ausgestrahlt am 16.04.2024 im SWR-Fernsehen (SWR-Story), Vorgaben im Wohnungsbau.
Plastisch arbeitet die Journalistin heraus, wie das Bauen in Deutschland mit zunehmender und teilweise erheblicher Regelungsdichte über die Jahre immer komplizierter und teurer geworden ist.
Mischke recherchiert, wie Normen entstehen und warum mangelnde Transparenz in den verantwortlichen Gremien des Deutschen Instituts für Normung dazu beitragen könnte, dass zu selten „Normen für das Normale“ gesetzt werden.
Hoffnung macht Mischke mit dem Porträt eines innovativen Bauunternehmers, der DIN-Vorgaben mutig hinterfragt und in seinen Projekten Maß und Mitte sucht.
Die Jury hebt hervor: Die Dokumentation bleibt nicht beim beklagenswerten Ist-Zustand stehen, sondern zeigt, wie mit unternehmerischem Einsatz und Risikobereitschaft Wohnungsnot gelindert und Verbesserungen für die Gesellschaft erreicht werden können.
-

"Worauf es bei der Recherche ankommt: dazuzulernen"
Es gibt viele Dokus über das Bauwesen – über die Pyramiden, die Chinesische Mauer, den BER. Tatjana Mischkes Film ist anders: Er zeigt, dass der wahre Endgegner beim Bauen heute oft nicht die Statik ist, nicht einmal der Feldhamster, sondern die neueste DIN-Norm …
Keine Frage: Normen sind toll. Sie sorgen dafür, dass es in Deutschland dichte Fenster gibt. Dass wir nicht jeden Ehestreit der Nachbarn durch die Wand hören, und dass Steckdosen mindestens 60 cm von einer Wasserquelle entfernt sind (falls der Ehestreit mal eskalieren sollte). Das ist nicht überall so. In England, zum Beispiel, sind dichte Fenster gänzlich unbekannt, und man kann seine Haare nicht vorm Spiegel im Bad föhnen. Da gibt es nämlich keine Steckdosen. Insofern: Ein Hoch auf Normen, die Sicherheit und Komfort bei uns ermöglichen.
Allerdings machte mich vor kurzem ein FAZ-Artikel stutzig, der sich mit dem Deutschen Institut für Normung beschäftigt (daher übrigens der Name DIN). Der langjährige Instituts-Chef Christoph Winterhalter sagt darin: „Wir verstehen Normung als Instrument der Deregulierung.” Es sei das Gegenteil von Bürokratie.
Ein Beleg dafür: Das DIN habe gerade erst den Entwurf einer neuen Norm zur Verkehrssicherheit von Wohngebäuden zurückgezogen. Dafür gab es aus der Wohnungswirtschaft Applaus. Mich beschleicht die Ahnung, dass dieser Applaus in Wahrheit Tatjana Mischke gebührt – und der Spätwirkung ihrer Doku.
Ursprünglich wollte sie einen Film über Öko-Bau machen. Ein wichtiges Thema. Zum Glück ist sie ergebnisoffen an die Recherche gegangen (was im Journalismus für sich genommen schon ein Wert ist) und landete ganz woanders. Sie ließ sich von den vielen offenen Fragen leiten, um zu begreifen, wie Baukosten mit Normen zusammenhängen.
Dabei lernen wir: Dünnere Wände sind nicht unbedingt dünne Wände. Franzosen und Niederländer haben nur halb so dicke Stahl-Betonteile als Decke wie das, was Sie eben im Preisträger-Film gesehen haben – und dennoch sind Häuser in Lyon und Maastricht stabil. Doppelt so viel Material kostet doppelt so viel Geld. Dennoch scheint für viele DIN-Normen entweder zu gelten: Mehr ist mehr, oder: Viel hilft viel. Wie solche Empfehlungen zustande kommen, das ist die Kernfrage der Doku. Und die lässt einen DIN-Vorstand im Interview ziemlich blass aussehen.
Meine Lieblingsstelle ist aber die mit den Steckdosen. Laut der neuesten Fassung der DIN Norm 18015 (XXXX) wären 18 Anschlüsse allein in der Küche ein guter Standard. Dann hören wir Tatjana Mischke im Gespräch mit einem Bauunternehmer sagen: „Jetzt ist ja das Einsparpotential bei Steckdosen, auch wenn es extrem viele Steckdosen sind, marginal.“ Da meldet der Unternehmer, Jan Eitel, sofort Widerspruch an. Und es folgt ein Steckdosen-Monolog: Nicht über die 14,95 Euro Stückpreis, sondern über die Prozesse hinter der Steckdose. Trockenbauwand, einseitig beplankt, nicht gedämmt, langes warten bis Elektriker, Kabel, und Aussparungen da sind. „Es geht also“, betont der Protagonist, „tatsächlich darum, jede einzelne Steckdose zu hinterfragen.” Ohne dass der Mieter später lange suchen muss, wo er den Staubsauger einstöpselt.
Ich kenne Kollegen, die – wenn es ihr Film gewesen wäre – die Anfangssequenz dieser Szene herausgeschnitten hätten. Da, wo der Unternehmer widerspricht. Doch Tatjana Mischke stört nicht, dass sie eines Besseren belehrt wird. Das macht sie nicht nur zu einer uneitlen Journalistin, sondern es zeigt, worauf es bei der Recherche ankommt: dazu zu lernen. Zum Beispiel, wer ein Interesse daran haben könnte, dass 18 Steckdosen in der Küche und 11 im Kinderzimmer sein sollen. Die Geheimhaltung, die um diese Antwort gemacht wird, gleicht einem Zeugenschutzprogramm.
Doch die Autorin fragt und recherchiert so lange, bis sie es verstanden hat. Damit wir es verstehen. Das alles gelingt ihr in nur 44 sehr anregenden Minuten – auch das eine Leistung für sich. Was man danach begriffen hat: Bauen in Deutschland ist auch deshalb so teuer, weil die Normierung an vielen Stellen das Maß verloren hat. Wenn „Normen für das Normale“ fehlen – macht das auch das Bauen für Normale immer schwieriger. Allerdings nicht unmöglich. Und auch das zeigt Tatjana Mischke.
Im Frühjahr 2024 sagte Bundeskanzler Scholz bei der Internationalen Handwerksmesse in München den bezeichnenden Satz: „Ich weiß als ehemaliger Hamburger Bürgermeister natürlich: Das Lied des Kaufmanns ist die Klage.“
Sie hier wissen, und auch Tatjana Mischke zeigt: Das Gegenteil ist der Fall. Ihr Film dokumentiert, und das ist aus Jury-Sicht der besondere Verdienst, wie mit unternehmerischem Einsatz und Risikobereitschaft Wohnungsnot gelindert werden kann und die Gesellschaft davon profitiert.
Ihr Film ist ein positiver Film: Über Menschen, die den Bau-Turbo gezündet haben – ohne dabei auf Bauministerin Verena Hubertz zu warten (die hoffentlich auch noch die Doku schaut, auf Youtube ist sie leicht zu finden). Hoffentlich nehmen sich viele ein Beispiel daran. Denn – das hat Ulrich Steinmeyer in dem Kurzfilm sehr richtig gesagt: „Ändern tut sich nur etwas, wenn es solche Filme gibt …“
Dafür zeichnen wir Tatjana Mischke mit dem Herbert Quandt Medien-Preis 2025 aus.
Herzlichen Glückwunsch!

12.500 Euro Preisgeld für Maren Adler
-

In der Reportage-Serien „Erfolgreich trotz Wirtschaftskrise“, ausgestrahlt vom HR-Fernsehen (Hessenschau) ab Dezember 2024, präsentiert Maren Adler sieben Erfolgsgeschichten hessischer Firmen. In herausfordernden Zeiten behaupten sie sich durch Erfindergeist und Unternehmertum.
Die erfahrene Fernsehjournalistin nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine spannende Bildungsreise durch die hessische Industrie. Ihre geschickte Kameraführung verknüpft authentische Interviews mit beeindruckenden Bildern aus der Produktion von gusseisernen Glocken, Hustensaft oder biologischem Kunststoffgranulat.
Die Juroren sind sich einig: Adlers Fernseh-Reihe führt fesselnd und abwechslungsreich vor Augen, wie Unternehmerinnen und Unternehmer Verantwortung übernehmen und in Krisen über sich hinauswachsen können.
-

"Geschichten von Mut, Ideen und Verantwortung"
Produktivität? Rückläufig. Investitionen? Auf Eis. Wachstum? Kaum spürbar. Kosten? Dafür umso höher.
Blickt man zurück auf die letzten Jahre, könnte man den Eindruck bekommen, die deutsche Wirtschaft – allen voran die Industrie – verliere an Kraft: schließt Werke, streicht Stellen, zieht sich schleichend zurück.
Doch es gibt sie – die anderen Geschichten. Geschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern,
.. die nicht viel fordern, sondern die Dinge selbst in die Hand nehmen.
.. die nicht hadern, sondern über sich hinauswachsen.
.. die nicht im Status quo verharren, sondern nach vorne schauen.
Es sind Geschichten von Mut, Ideen und Verantwortung.
Geschichten, die zeigen: Die deutsche Wirtschaft hat nicht nur Probleme. Sie hat nach wie vor Potenzial – und das steckt nicht nur in Tradition und Technologie, es steckt vor allem in den Menschen.
Sieben solcher Geschichten erzählt Maren Adler mit packenden Bildern und stimmiger musikalischer Untermalung – und sie geht dabei nah ran: in der Produktion genauso wie in den Gesprächen mit den Protagonisten.
Sie lässt es menscheln in der Wirtschaft: Sie lässt Jens Meyer zu Drewer, den Geschäftsführer von Biowert, durch die Grasernte harken, Julia Esterer das Innere eines Tankfahrzeugs erklären und Stephan Koziol das unkaputtbare Glas demonstrieren.
Und ich glaube, hier wird zur Stärke, dass Maren Adler aus der Kultur kommt – und Wirtschaft eben nicht ihr, wie sie es nennt, „Steckenpferd“ ist.
Vor Zahlen scheut sie dennoch nicht zurück: Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es in Deutschland mehr als vier Millionen Hektar sogenanntes Dauergrünland gibt – und damit sehr viel Gras für Biowert und ihre nachhaltige Kunststoff-Produktion.
Auch der Blick in die Firmengeschichten könnte aktueller nicht sein: So erzählt Hanns Martin Rincker, Unternehmer in 13. Generation, dass die Gießer, um den Zöllen zu entgehen, schon vor hunderten Jahren über Monate in der Gemeinde lebten, für die sie Glocken fertigten. Und dass jeder Glocken- auch Kanonengießer war.
Man erfährt, wie unterschiedlich die Firmen in der Corona-Pandemie gelitten haben – und die Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihnen.
Und in jedem Teil klingen auch die Herausforderungen für die Wirtschaft an, die es zweifelsohne gibt: von Fachkräftemangel über hohe Kosten – ob für Energie oder Personal – bis hin zu Werksspionage.
Wirtschaftsjournalismus, meine Damen und Herren, muss enthüllen, erklären und einordnen – und dabei immer die Realität abbilden. Er darf nicht beschönigen, aber durchaus Wege aus der Krise aufzeigen und so Zuversicht verbreiten.
Und siehe da: Nach mehr als zwei Jahren mit schwachem Wachstum hat die deutsche Wirtschaft zuletzt wieder positive Signale gesendet.
Das ist zwar mehr ein Zeichen für verhaltene Erholung als für fulminante Euphorie, aber ich denke, wir alle täten gut daran, es mit den Worten von Julia Esterer im Film zu halten: „Wir packen es an. Wir kommen da durch. Ich hab‘s im Griff.“
In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch an Maren Adler für ihre Reportageserie „Erfolgreich durch die Wirtschaftskrise“!

12.500 Euro Preisgeld für Laura Borchardt und Julia Saldenholz
-

Der Fachkräftemangel trifft die Gastronomie- und Hotelbranche hart. In ihrer Dokumentation „Herr D. sucht die Fachkraft“, ausgestrahlt am 26. Februar 2024 im NDR-Fernsehen (NDR-Story), begleiten Laura Borchardt und Julia Saldenholz den Geschäftsführer eines Ferienparks an der Ostsee bei seinen Bemühungen, dringend benötigtes Personal im Ausland anzuwerben.
Die Filmemacherinnen zeichnen das Porträt eines Unternehmers, der sich selbst ins Flugzeug nach Madagaskar setzt und trotz immenser bürokratischer Hürden nie aufgibt. Zugleich beleuchtet die Dokumentation nahbar und empathisch die Perspektive der hoffnungsvollen Jugendlichen des Inselstaats, die bereit sind, für eine Ausbildungsstelle in Deutschland viel zu investieren und ihre Heimat zu verlassen.
Die Jury würdigt die beeindruckende Recherchetiefe und die überzeugende narrative Balance zwischen dem Zukunftsoptimismus der jungen Menschen und der harten Realität zäher Verwaltungsprozesse in Deutschland.
-

“Man fiebert mit, schüttelt den Kopf, ist fast auch erschöpft …”
Die Kunst von Trends und Megathemen ist es, diese auf Menschen und Beispiele herunterzubrechen. Solche Texte, Filme und Beiträge kennen wir zuhauf – etwas passiert und in einem Beitrag mit Zahlen und Zitaten gibt es ein Beispiel. Ein Unternehmer berichtet von seinen Lieferketten, die durcheinander sind. Von Energie, die zu teuer ist. Oder von Projekten, mit denen er oder sie KI eingeführt hat. Pars pro toto. “Show, don’t tell”, nennt man das in amerikanischen Writing Classes.
„Such' ein paar Beispiele und Betroffene“, so lautet auch der bekannteste Tagesauftrag nach einer Redaktionskonferenz. Umgekehrt gibt es eine ungeschriebene Regel: Wenn man selbst drei Beispiele zusammen hat, kann man gerne auch mal einen Trend ausrufen. Das sind dann die Immer-mehr-Geschichten: „Immer mehr Menschen träumen nachts von ihren Haustieren…“. Oder, um ein Beispiel für diese Rahmen zu finden: „Immer mehr Unternehmen nutzen KI für ihre Personalsuche.“
Personalsuche, damit sind wir beim Thema. Aber es geht nicht um KI, sondern um urmenschliche Intelligenz (und Empathie), Fachkräfte zu finden. Und zwar nicht mit ein paar schnellen, oberflächlichen Beispielen, sondern einem „Deep Dive“. Das macht diesen Film besonders, er ist exemplarisch, aber sehr ehrgeizig in der Recherche – nah dran, authentisch und leidenschaftlich im Storytelling.
Laura Borchardt und Julia Saldenholz begleiten in ihrem Film David Depenau, den Geschäftsführer im Ferienpark Weissenhäuser Strand, auf einer großen Suche, die um den halben Globus führt, bis nach Madagaskar. Schon bald reist und fiebert man mit dem Unternehmer mit, der das macht, was Unternehmtum ausmacht: Er nimmt die Dinge selbst in die Hand. Er tut etwas. „Es gibt keinen Ersatz für Umsatz“, sagt er gleich zu Beginn. Man könnte hinzufügen: Einsatz macht Umsatz.
Der Fachkräftemangel in der Gastronomie- und Hotelbranche ist omnipräsent. Und es gibt viele Beiträge mit Zitaten von Gastwirten, die klagen. Der Film schafft es in einer beeindruckenden Intensität dieses Problem umfassend und lebendig zu beleuchten. Er kommt dem Unternehmer nahe, lässt ihn sprechen, machen, entscheiden, ohne dass es gestellt aussieht, ein Mann, der sich nicht unterkriegen lässt. Oder seinen tapferen, fantastischen Mitarbeiterinnen in der Personalabteilung. Man fiebert mit, schüttelt den Kopf, ist fast auch erschöpft, wenn man erlebt, welche Hürden der deutsche Staat, die zu oft bemühte Bürokratie, solchen Initiativen bereitet.
Der Film schafft in einem zweiten Erzählstrang noch etwas anderes: Er verändert den Blick auf Migration, die seit Monaten sehr einseitig geführt wird. Aber ohne moralischen Zeigefinger, ohne künstliche Belehrung – er erzählt die Geschichten von Menschen aus Madagaskar, die alles dafür tun, um nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten – in Jobs, auf die viele hier keine Lust mehr haben. Sie lernen Deutsch, verlassen ihre Familien, gehen durch eine harte Ausbildung und sehen Deutschland als große Chance. Ohne sie könnte der Betrieb dieses Ferienparks nicht aufrechterhalten werden. Dieser Perspektivwechsel auf das Dauerthema Migration gelingt vorbildlich.
Wenn man Herrn Depenau googelt, darf man sich freuen – er hat inzwischen Karriere gemacht, also medial: Sechs Monate nach Erscheinen des Film feierte ihn die Zeit als „Der Chef, zu dem alle wollen“. Zitat: „Sie kommen aus Madagaskar, aus Indien, der Türkei. Und haben ein Ziel: den Weissenhäuser Strand an der Ostsee. Warum Fachkräfte hier arbeiten möchten.“
Der Film von Laura Borchardt und Julia Saldenholz ist aufwändig recherchiert und nah dran, intensiv, aber nie aufdringlich, er ist packend erzählt, ohne aufzubauschen.
Diese journalistische Leistung zeichnen wir mit Freude mit dem Herbert Quandt Medienpreis und 12.500 Euro Preisgeld aus.
Herzlichen Glückwunsch Laura Borchardt und Julia Saldenholz!
Der Herbert Quandt Medien-Preis würdigt seit 1986 jährlich Journalisten und Publizisten aller Medien, die sich in anspruchsvoller und allgemeinverständlicher Weise mit dem Wirken und der Bedeutung von Unternehmern und Unternehmen in der Marktwirtschaft auseinandersetzten. Der Medien-Preis wird im Gedenken an die Persönlichkeit und das Lebenswerk des Unternehmers Dr. h.c. Herbert Quandt verliehen und mit insgesamt 50.000 Euro dotiert.

Dr. h.c. Herbert Quandt (1910-1982)
Herbert Quandt wurde am 22. Juni 1910 als zweiter Sohn des Unternehmers und Industriellen Günther Quandt (1881-1954) und seiner Frau Antonie (geb. Ewald; 1884-1918) in der brandenburgischen Stadt Pritzwalk geboren.
Nach dem frühen Tod der Mutter zog Herbert mit seinem Vater Günther und dem älteren Bruder Hellmut nach Berlin, wo er infolge einer schweren und nicht heilbaren Augenerkrankung Privatunterricht und Ausbildung durch Hauslehrer erhielt. Sein Vater plante daher, ihm eine berufliche Zukunft in der Verwaltung des familieneigenen landwirtschaftlichen Gutes in Mecklenburg zu eröffnen. Nachdem sein älterer Bruder Hellmut jedoch 1927 im Alter von nur 19 Jahren den Komplikationen einer Blinddarmentzündung erlag, wurde Herbert Quandt von Günther Quandt auf eine industrielle Verantwortung und Nachfolge in der Unternehmensgruppe vorbereitet.
Mit Beginn der dreißiger Jahre sammelte Herbert Quandt im Rahmen von Praktika und zahlreichen Auslandsaufenthalten Erfahrungen sowie technische und kaufmännische Kenntnisse, vor allem in der Entwicklung und Produktion von Akkumulatoren. Ende der dreißiger Jahre wurden ihm zunehmend Führungsaufgaben in der Quandt-Gruppe, insbesondere bei dem Batteriehersteller Pertrix, übertragen. Zwar stand Herbert Quandt während der Zeit des Nationalsozialismus immer noch im Schatten seines Vaters. Er trug aber als Direktor der Batteriefabriken Pertrix und AFA Oberschöneweide Verantwortung für den Personalbereich, der sich auch mit dem Einsatz und den Arbeitsbedingungen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern befasste.
Die Bedingungen der Zwangsarbeit, aber auch das politische Verhalten seines Vaters Günther Quandt in der NS-Zeit, wurden im Oktober 2007 in der TV-Dokumentation „Das Schweigen der Quandts“ thematisiert. Die Ausstrahlung dieser Dokumentation sowie deren Echo in der Öffentlichkeit gaben den Anstoß für eine umfassende Aufklärung und Gesamtdarstellung der Familiengeschichte.
Im Dezember 2007 bat die Familie Quandt, deren seinerzeit größte Beteiligungen BMW und ALTANA sich als Gründungsmitglieder in der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft schon im Jahr 2000 für einen materiellen Ausgleich für ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt hatten, den Zeithistoriker Prof. Joachim Scholtyseck (Universität Bonn) um eine wissenschaftliche Gesamtdarstellung der Familiengeschichte. Das dreijährige, tiefgreifende Forschungsprojekt reichte von den unternehmerischen Anfängen in der Kaiserzeit des 19. Jahrhunderts über die beiden Weltkriege bis zum Tode Günther Quandts im Jahr 1954 und wurde 2011 unter dem Titel „Der Aufstieg der Quandts“ veröffentlicht.[1]
Scholtyseck verdeutlicht darin, dass Herbert Quandt durch seine Führungsaufgaben in der Quandt-Gruppe über Art, Umfang und Bedingungen der Zwangsarbeit sowie auch über sog. „Arisierungen“ von Unternehmen informiert gewesen sein muss.[2] Die Mitgliedschaft in der NSDAP und anderen NS-Organisationen erleichterten es ihm zudem, während des Krieges in Deutschland als Unternehmer tätig zu bleiben.
Scholtyseck erwähnt in seiner Studie aber auch, dass Herbert Quandt „Mitarbeiter in seinen Wirkungskreis berief, die zuvor schon mit dem Regime in politische Konflikte geraten waren“.[3] Da es „weder (…) zeitgenössische Hinweise auf eine grundlegende Distanz zum Regime, noch (…) Indizien für eine besondere Nähe“ gebe, kommt der Historiker zu der Beurteilung, dass „Herbert Quandt zu den vielen Mitläufern gehört habe“.[4]
Das Schweigen über die NS-Zeit und ihr großes Unrecht wurde nach dem Krieg von Herbert Quandt nicht durchbrochen. Scholtyseck verweist auf den Versuch einer Erklärung durch den Philosophen Herrmann Lübbe: Dieser habe im kollektiven „kommunikativen Beschweigen“ eine Voraussetzung dafür gesehen, dass sehr viele, die dem NS-Regime gedient oder sich zumindest mit ihm arrangiert hatten, nach dem Krieg wieder auf einen Weg des Rechts und der Moral zurückfanden und sich engagiert und mit unternehmerischer Zuversicht in den neuen demokratischen Staat einbrachten.[5]
So war auch das Wirken Herbert Quandts in der jungen Bundesrepublik, in der er selbstbestimmt seinen eigenen Überzeugungen folgen konnte, gekennzeichnet von seinem engagierten Bekenntnis zur neuen sozialen Marktwirtschaft und verantwortungsvollem Unternehmertum. Nach seiner Auffassung sollte der Unternehmer in der Gesellschaft als Mensch wahrgenommen werden, dessen Tun und Handeln über den ökonomischen Nutzen hinaus einen wichtigen sozialen Beitrag leistet. Dabei fand neben der Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Unternehmenserfolg auch die Ausbildung junger Menschen das besondere Augenmerk Herbert Quandts: Für seine Verdienste um die Reformierung des betrieblichen Ausbildungswesens erhielt er im November 1956 die Ehrendoktorwürde der Universität Mainz.
Auch durch eine besondere unternehmerische Leistung reifte Herbert Quandt zu einer der prägenden und visionären Persönlichkeiten der bundesdeutschen Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte: So bewies er Wagemut und Weitblick, als er 1960 die Aktienmehrheit an der Bayerischen Motorenwerke AG übernahm und das Unternehmen damit vor der Übernahme durch die Daimler-Benz AG bewahrte. Mit seinem großen persönlichen Einsatz, der mit dem enormen Risiko des finanziellen Totalverlusts verbunden war, sicherte Herbert Quandt die Unabhängigkeit von BMW und führte das Unternehmen damit in den folgenden Jahrzehnten zurück auf die Erfolgsspur.
Herbert Quandt vertrat zugleich die Überzeugung, dass Wirtschaft den Menschen als Lebens- und Chancenraum erklärt und nahegebracht werden muss. Neben ihrer Bedeutung als kritische Vermittler und unabhängige Beobachter sah Herbert Quandt hierin die wichtigste Aufgabe der Medien.
[1] Vgl. Joachim Scholtyseck, Der Aufstieg der Quandts. Eine deutsche Unternehmerdynastie, München 2011
[2] Vgl. ebd., S. 765 f.
[3] Vgl. ebd., S. 767
[4] Vgl. ebd., S. 767
[5] Vgl. ebd., S. 768
Newsletter zum Herbert Quandt-Medien-Preis
Bleiben Sie auf dem Laufenden! Lassen Sie sich mit dem Newsletter der Johanna-Quandt-Stiftung über Neuigkeiten rund um den Herbert Quandt Medien-Preises informieren.
Bis zu vier Mal im Jahr verschicken wir aktuelle News über Bewerbungsmöglichkeiten, Preisträger und die Preisverleihung.
Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse eintragen und auf "Senden" klicken, erklären Sie sich mit dem Erhalt des Newsletters einverstanden. Nach der Bestellung erhalten Sie von uns eine E-Mail, in der Sie Ihre Einwilligung bestätigen müssen (Double-Opt-In-Verfahren).
Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Dies ist möglich durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail an info@johanna-quandt-stiftung.de oder durch eine Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten.
Mit der Bestellung des Newsletters bestätigen Sie, die Datenschutzerklärung der Johanna-Quandt-Stiftung zur Kenntnis genommen zu haben.